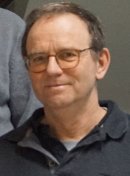Deutschunterricht ist Sprachunterricht
Deutschunterricht muss Sprach- und Kognitionsunterricht sein – Interview mit Claus Maas: deutschlandfunk.de
Einschätzung zur Lage des Deutschunterrichts an den Schulen
„Deutschunterricht ist Sprachunterricht“! Diese Forderung scheint der Didaktik seit Jahrzehnten immer mehr aus dem Blick geraten zu sein: Die Sprache und ihr Gebrauch sind eine Kunst, die es zu erlernen und zu vertiefen gilt – durch eigenes aktives Handeln, aber auch über ständige Begleitung und Korrektur durch erfahrene und geübte Sprecher und Schreiber. Welche Fehler wurden in den vergangenen Jahrzehnten gemacht, und worauf muss sich Unterricht – gerade unter dem Aspekt der zunehmenden Digitalisierung des Unterrichts in allen Fächern?
Fehlentwicklungen des Deutschunterrichts seit Jahrzehnten
- Die Bedeutung der Orthographie für den frühen Schriftspracherwerb wurde planmäßig herabgestuft und ihre Bedeutung auch in der Bewertung schriftlicher Leistungen in fortgeschrittenen Lernphasen mehr und mehr reduziert.
- Die Wortschatzarbeit wurde im Bereich des „muttersprachlichen“ Unterricht im Gegensatz zum fremdsprachlichen praktisch als irrelevant eingestuft. Dadurch wurde das sprachliche Ausdrucksvermögen der Schüler kaum mehr aktiv gefördert.
- Darunter litten nicht zuletzt die Anforderungen an den Umfang und an den gedanklichen Gehalt von durch die Schüler selbst zu verfassenden Texten.
- Durch die Reduktion schriftlicher Klassenarbeiten und die Aufwertung so genannter „mündlicher“ Leistungsformate sanken die Anreize für eine gründliche gedankliche Durchdringung von Gegenständen und Sachverhalten.
- Durch die Vereinfachung und Verflachung der Aufgabenformate wurden analytische und abstrahierende Anforderungen immer mehr zugunsten reproduktiver Leistungsanteile und „kreativer“ Schreibimpulse zurückgedrängt. Das führte zur Vernachlässigung des Anspruchs an eigene Denk- und schriftsprachliche Leistungen.
Erschreckend ist z. B. die Tatsache, dass inzwischen schon im Deutschunterricht der Gymnasialen Oberstufe klassische Texte in so genannter „Einfacher Sprache“ behandelt werden – die den Schülern abzuverlangende sprachliche Horizonterweiterung und die Stärkung der Verstehensfähigkeit („Lesekompetenz“) bleibt schon in der unterrichtlichen Anforderung auf der Strecke ! (vgl. hierzu: Heike Schmoll, Lessing büßt das Versmaß ein – FAZ 6. Februar 2026) Ausdruck, aber auch Folge einer Lehrauffassung, die offensichtlich Anforderung und Herausforderung mit „Überforderung“ gleichsetzt – und sich dabei letztlich für vermittlungsunfähig erklärt!
Für den mündlichen und schriftlichen Sprachunterricht muss aber von der Orientierungsstufe bis in die Gymnasiale Oberstufe die Forderung lauten: Üben, üben, üben!
Wer aber z. B. eine Sportart wie Tennis und Fußball oder ein Instrument wie Klavier oder Geige, wer ein Spiel wie Schach erlernen und seine Fähigkeiten darin entwickeln will, für den gilt, dass die virtuose Beherrschung dieser Kunst nur durch konsequente Einübung elementarer Techniken und ständiges Üben erreichbar ist. Wieso sollte das beim Erwerb von sprachlichen Fähigkeiten anders sein?
Grundsätze und Forderungen für guten Sprachunterricht
- Wie für jedes Fach gibt es für die Sprache elementare und allgemein- verbindliche Grundlagen. Dazu gehören die Fähigkeiten zu lesen, zu schreiben, zu verstehen und zu formulieren.
- Sprache hat den Stellenwert eines Mediums, das die Verständlichkeit von Kommunikation für alle Bereiche zwischenmenschlicher Interaktion sicherstellen und damit zur Verständigung über individuelle und soziale, rationale und emotionale, gegenständliche und abstrakte Sachverhalte und Beziehungen gewährleisten muss.
- Darüber hinaus kann Sprache ein Produkt kreativer und künstle-rischer Gestaltung sein, das subjektiven und innovativen Ideen und Konzepten Ausdruck verleiht. In diesem Sinne ist Sprache ein Medium von Literatur und zugleich Ausdruck von geistiger und kultureller Weiterentwicklung.
- Sprachunterricht dient der Vermittlung und Bewusstmachung dieser verschiedenen Ebenen von Sprache – er dient aber insbesondere der Entwicklung von Persönlichkeit, die Schüler in die Lage versetzt, an den in ihrer Umgebung stattfindenden kommunikativen Prozessen angemessen und produktiv teilzunehmen.
Wir fordern daher u.a.:
- Deutschunterricht muss wieder die Förderung der aktiven Sprachkompetenz aller Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt stellen.
- Deutschunterricht beinhaltet über Lernphasen und Jahrgangsstufen hinweg ein prozessuales Lernen, das die Erweiterung und Entwick-lung elementarer sprachlicher Kompetenzen zum Gegenstand hat
- dazu gehören:
- Korrektes und verständliches Sprechen und Schreiben, Beherrschung und Anwendung grundlegender grammatischer Formen und Muster über das bloße Erkennen hinaus, Unterscheidung von Alltags- und Standardsprache, Fähigkeit des sach- und situationsangemessenen Formulierens
- Variabilität und Differenzierungsfähigkeit im sprachlichen Ausdruck durch fortschreitende Wortschatzerweiterung, bewusster Anwendung von Tempus- und Modusformen sowie durch Satzbau-elemente, Para- und Hypotaxen.
- Fähigkeit zur Unterscheidung und zur sprachlichen Repräsentation sprachlich-gedanklicher Darstellungsperspektiven, namentlich: Erzählung, Bericht, Beschreibung, Erklärung, Wiedergabe durch indirekte Rede, Argumentation und Erörterung.
- Fähigkeit zur Systematisierung von Wahrnehmungen nach sprach-lichen Kategorien sowie Ausbildung von Abstraktionsfähigkeit.
- Ausformung einer auf Tatsachenwahrnehmung und multiper-spektivischer Abwägungsfähigkeit basierenden Urteilsfähigkeit angesichts komplexer Sachverhalte.
Unsere Zielvorstellung:
Sprachunterricht ist frei von politischer und weltanschaulicher Beeinflussung, er hat vielmehr die Aufgabe, junge Menschen bei der Ausbildung ihrer Persönlichkeit zu begleiten, und fördert die Entwicklung von geistiger Eigenständigkeit in sozialer Verantwortung.
Der Erwerb einer eigenen kritischen Urteilsfähigkeit schafft die Voraussetzung für ihre verantwortungsvolle Teilnahme an einem freiheitlichen gesellschaftlichen und politischen Willensbildungsprozess.
Stärkung des aktiven Sprachunterrichts
Erschreckend war es daher bei der Durchsicht des seinerzeit neuen Lehrplanentwurfs 2019 festzustellen, dass der Satz „Deutschunterricht ist Sprachunterricht“ in der neugefassten Einleitung keinen Platz mehr hatte. Es war unsere Intervention, die schließlich bewirken konnte, dass der Satz wieder aufgenommen wurde (siehe unter Weitere Themen, Kehrplan für Sekundarstufe I 2019). Auch die Diskussion um den neuen Lehrplan Deutsch Gymnasiale Oberstufe (hier bezogen auf NRW) zum Schuljahresbeginn 2023/2024 machte deutlich, dass immer weniger fachbezogene individuelle Fähigkeiten (also sprachliche Kernkompetenz im wörtlichen Sinne) im Vordergrund des Unterrichts stehen als vielmehr „Sozialkompetenz“ in ihren weitläufigen Aspekten.
Dabei ist die Erkenntnis, dass die sprachlichen Fähigkeiten von Grund- und Sekundarschülern immer schlechter werden, inzwischen eine Binsenweisheit – eine Studie nach der nächsten kommt zu dem immer gleichen Ergebnis.
Die Duden-Redaktionsleiterin Kathrin Kunkel-Razum erklärt dazu in einem Spiegel-Interview aus Anlass des Erscheinens der aktuellen Neuauflage des Rechtschreib-Dudens:
„Den Deutschunterricht zu stärken, ist sinnvoll. Aber mitunter zweifle ich an den didaktischen Methoden.“ (Der Spiegel 24/24)
Diesen Zweifel kann man – im Gegensatz zu den Auffassungen Frau Kunkel-Razums zur Gendersprache – nur bestätigen.
Auch die „Studie zur Lage der deutschen Sprache in Schulen“ der Akademie für deutsche Sprache und Literatur aus dem Jahr 2022 spiegelt die Erkenntnis wider, dass die Didaktik der vergangenen Jahrzehnte in die falsche Richtung lief – dass man verstärkt die „konzeptionelle Schriftlichkeit“ in den Mittelpunkt der Unterrichtssprache stellen müsse. (esv.info)
Leider ist von dieser Forderung in den aktuell geltenden Lehrplänen noch wenig bzw. nichts angekommen. (Dies mag für einzelne Bundesländer in unterschiedlichem Maße gelten, darf aber als durchgängiges Phänomen angenommen werden.)
Aktuelles
Wie die neuen Kernlehrpläne weiter in die falsche Richtung marschieren
Angesichts der flächendeckenden Wiedereinführung der 9-jährigen Gymnasialzeit werden in diesem Jahr (2026) auch die Kernlehrpläne Deutsch für die Gymnasiale Oberstufe überarbei-tet. Der Entwurf für das Land NRW schließt in erschreckender Weise an die vorangegangenen Fehlentwicklungen der vergangenen Jahrzehnte an. Neue Erkenntnisse aus einer aufmerksa-men Fachdidaktik finden darin kaum Eingang. Lesen Sie dazu den Kommentar des VDS zum Entwurf des Kernlehrplans unter:
Im Jahr 2021 veröffentlichte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung (in Zusammen-arbeit mit der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften) den „Dritten Bericht zur Lage der deutschen Sprache“ unter Federführung führender Sprachdidaktiker wie Prof. Helmuth Feilke und Prof`in Ursula Bredel.
Schwerpunkt der Untersuchung waren Erscheinungsbild und Entwicklungstendenzen der „Sprache in Schulen“ als einer „Sprache im Werden“.
Unter den dort untersuchten Bewertungsaspekten wurde – unbeschadet der Berücksichtigung der unabweisbaren sozial-strukturellen und medial-affektiven Faktoren – vor allem das Erfordernis einer stärker bildungssprachlich ausgerichteten und an so genannter „konzeptioneller Schriftlichkeit“ orientierten Unterrichtsgestaltung hervorgehoben.
Als Kernsatz der darin dargelegten Erkenntnisse über die Ausrichtung und die Wirksamkeit des Deutschunterrichts der vergangenen Jahrzehnte zitiere ich aus der Zusammenfassung:
„Wortschatz, Grammatik und Rechtschreibung, dieser Dreiklang bestimmt den Kanon des im Schulalter zu entwickelnden und zu fördernden produktiven Sprachkönnens und Sprachwissens.
Dabei liegt der Fokus für diesen Bericht nicht auf dem Wissen über Sprache, den reflexiv-bewussten metasprachlichen Fähigkeiten und Kenntnissen […]. Der Bericht konzentriert sich darauf, wie die Schülerinnen und Schüler die Sprache gebrauchen.“
(Bredel/Feilke a.a.O.S.25)
Eine Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen der wissenschaftlichen Untersuchungen von Feilke, Bredel u.a. ist in dem vorliegenden Entwurf aber nicht zu erkennen.
Nach wie vor behandelt der hier vorgelegte Lehrplan überwiegend wissens-, bestenfalls verstehensorientierte Kompetenzbeschreibungen: in den aufgelisteten Kompetenzerwartungen werden weiterhin die „Kenntnis“ und die „Beurteilung“ oder „Bewertung“ von lexikalischen, grammatikalischen und handlungsbezogenen sprachlichen Gestaltungsmustern gefordert, nicht aber deren zielführende und kommunikativ erforderliche bewusste Anwendung.
Dies betrifft zum einen die Beschreibung der „Aufgaben und Ziele des Faches“ (Seite 7f. des Entwurfs) zum andern die Abschnitte 2.1 und 2.2 des Entwurfs (Seiten 11-17)
Besonders auffallend ist, dass selbst der Begriff der „konzeptionellen Schriftlichkeit“, dem in der Feilke/Bredel-Studie ein hoher Aufmerksamkeitsbedarf zugesprochen wird, weder in den analytischen Betrachtungen zum Lehrplanentwurf (die es im übrigen – im Gegensatz zu den früheren „Richtlinien für den Deutschunterricht in der gymnasialen Oberstufe“ gar nicht mehr zu geben scheint) noch in der Umsetzung der zu vermittelnden und zu fordernden Kom-petenzen eine Rolle spielt. Im Gegenteil: den Begriff der „konzeptionellen Schriftlichkeit“ wie er von Feilke/Bredel in die Diskussion gebracht wird, würdigen die Entwurfsverfasser zu einem bloßen Gegenstand der unterrichtlichen „Beurteilung“ durch die Schülerinnen und Schüler herab, anstatt diese zum Maßstab der von ihnen zu erwerbenden sprachlichen Kompetenzen zu nehmen. (Entwurf Seite 15)
Anstatt Konsequenzen aus den vorliegenden Erkenntnissen zu ziehen und den Empfehlungen der Hochschuldidaktik Aufmerksamkeit zu schenken, verharrt der Lehrplanentwurf in den Denkmustern der vergangenen Jahrzehnte. Er verwendet viel Mühe auf die Akzentuierung fachübergreifender Kompetenzen, statt sich den fachspezifischen Fähigkeiten zu widmen, die die künftigen Berufsanfänger, Studenten und sozial verantwortlich handelnden Erwachsenen sprachlich und intellektuell in die Lage versetzen sollen, aktive und überzeugende Beiträge zur Gestaltung einer demokratischen, sozialen, ökonomisch und ökologisch zukunftsfähigen Gesellschaft zu leisten.
Der Entwurf verharrt in der Illusion, dass sich bildungssprachliche Kompetenz im Zuge des schulischen Lernens und in der Auseinandersetzung mit „kommunikativen“ Inhalten und Formen von selber einstellt – statt durch unterrichtlich intendierte und angeleitete individuelle bzw. persönliche sprachliche Weiterentwicklung. Sichtbar wird das nicht zuletzt in der fehlenden Klassifikation und Differenzierung kommunikativer Formen bzw. Formate durch die immer noch feststellbare didaktisch problematische Ausblendung des Begriffs „Bildungssprache“.
Warum „Deutsch in der Schule“ für uns ein Thema ist
Klagen von Hochschuldozenten, Ausbildungsbetrieben, Behörden und Akademien über mangelhafte sprachliche Fähigkeiten der Schulabgänger sind inzwischen alltäglich. Zeitungen sind voll mit Leserbriefen und Berichten, in denen die Verrohung und Verflachung der öffentlichen Sprache angeprangert werden. Die Ausbreitung von Anglizismen und eine unangemessene Verwendung von Umgangssprache sowie vielfach fehlerhafter Sprachgebrauch dominieren in den Medien, zugleich fehlt es an Vorbildern, die dem Sprachverfall entgegenwirken.
Eine zentrale Rolle bei Wahrung und Pflege des Sprachgebrauchs kommt dem Deutschunterricht in unseren Schulen zu. Erfahrenere Lehrerinnen und Lehrer wissen aber, dass Richtlinien und Lehrpläne den Aspekten der Sprachrichtigkeit
und der Vielfalt des sprachlichen Ausdrucks immer weniger Bedeutung beimessen. Bei Lernstandserhebungen und Bewertungskriterien für schriftliche Arbeiten spielen diese kaum noch eine angemessene Rolle. Seit Jahrzehnten gibt es in den meisten Bundesländern an weiterführenden Schulen keine benoteten Diktate und keine verbindlichen Vorgaben für die Wortschatzerweiterung mehr (die im Fremdsprachenunterricht selbstverständlich sind). Die Ausarbeitung eigener Texte wird durch die aktuellen Aufgabenformate in der Sekundarstufe I immer weniger gefordert, das Nachdenken über
angemessene Formulierungen unter den engen Zeitvorgaben für schriftliche Arbeiten massiv erschwert und einer differenzierten Sprachgestaltung zu wenig Beachtung geschenkt.
Studie zur Lage der deutschen Sprache in Schulen
Die Klagen über mangelnde Sprachkompetenz von Schulabgängern sind nicht neu. Der VDS hat bereits im Jahr 2019 eine (nicht repräsentative) Erhebung unter etwa 100 Ausbildungsbe-trieben in verschiedenen Regionen des Bundesgebietes durchgeführt, die den Eindruck bestätigte, dass es um die elementaren Fähigkeiten des Schreibens und des sprachlichen Ausdrucks durchweg nicht gut bestellt ist. Grundlegende sprachliche Mängel in den schriftlichen und den Leseleistungen der Auszubildenden seien keineswegs nur bei Beteiligten mit familiärem Migrationshintergrund festzustellen, sondern auch unter Schulabgängern, die diesen Nachteil nicht haben.
Bei den zur Zeit in einigen Bundesländern stattfindenden Beratungen über eine Neufassung der geltenden Kernlehrpläne für Deutsch in der Sekundarstufe II spielen die Überlegungen dazu durchaus eine Rolle. Der VDS beteiligt sich namentlich in NRW im Rahmen der vorge-sehenen Verbändebeteiligung an den Beratungen und achtet dabei darauf, dass der Gedanke der sog. „konzeptionellen Schriftlichkeit“ die nötige Aufmerksamkeit erhält. Unter „konzeptioneller Schriftlichkeit“ ist zu verstehen, dass an der Schule (in allen Fächern,) nicht nur im Deutschunterricht eine bildungssprachliche Ebene zur Grundlage der Kommunikation bzw. zur Interaktion gemacht werden sollen. Sprachunterricht zielt darauf ab, auch im mündlichen Sprachgebrauch Standards zu wahren, die für den Schriftsprachgebrauch als angemessen gelten.
Besitzen Schulabgänger heute noch die elementaren Fähigkeiten des sprachlichen Ausdrucks?
Der Spiegel (Nr. 11-2021) berichtet über eine Auswertung von Abiturklausuren im Fach Deutsch aus den Jahren 1984 und 1985. Diese wurden, nachdem sie in einem Gymnasium am Bodensee zufällig aufgefunden worden waren, mit aktuellen Abiturarbeiten aus dem Jahrgang 2019 verglichen. Das Ergebnis kann nicht überraschen:
Die Leistungen im Hinblick auf Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik und die Qualität des sprachlichen Ausdrucks haben deutlich erkennbar nachgelassen: Wiesen Abiturarbeiten im Fach Deutsch vor 35 Jahren eine durchschnittliche Fehlerquote von 1,5 auf 100 Wörter auf, so waren es 2,2, auf 100 im Jahr 2019 – also eine Fehlerzunahme von rund 50 %. (Dabei blieben Klausuren, die 2019 mit weniger als 6 Punkten – also noch glatt ausreichend – bewertet wurden unberücksichtigt, um ungleiche Voraussetzungen bei der Auswahl der Abiturfächer auszugleichen, denn leistungsschwächere Schüler konnten 1984/85 das Fach Deutsch als Fach der schriftlichen Abiturprüfung abwählen.)
Die Auswertung macht nach Ansicht der Autoren deutlich, dass etwa die große Rechtschreibreform von 1996 mit den vorgenommenen Vereinfachungen des Regelsystems den angekündigten Effekt (mit Ausnahme der Zeichensetzungsfehler) schuldig blieb . Im Gegenteil seien bestimmte Fehlertypen wie die Verwechslung von „das“ und „dass“ (früher „daß“) sogar häufiger geworden.
Eine der Ursachen sehen die Verfasser neben den Einflüssen digitaler Kommunikationsmöglichkeiten und dem allgemeinen Verlust an Schriftlichkeit vor allem in der Lernmethode des „Schreibens nach Gehör“ in den Grundschulen.
Aber auch die Vernachlässigung der korrekten Behandlung von grammatischen Phänomenen in der medialen Öffentlichkeit, z.B. des Konjunktivs in indirekter Rede oder des richtigen Kasusgebrauchs trügen zum Qualitätsverlust bei.
Der Spiegel zitiert die Professorin für Deutsche Sprachdidaktik Julia Knopf, die vor der im öffentlichen Raum häufig vernehmbaren Ansicht warnt, Rechtschreibung sei doch heute nicht mehr so wichtig, solange der Sinn einer Aussage oder eines Gedankengangs verständlich sei. Genau das sei aber aufgrund der sprachlichen Mängel heute schon bei vielen Abiturarbeiten in Teilen nicht mehr der Fall.
Schon im Jahrgang 2019/2020 hat der VDS durch eine Umfrage unter ausgewählten (mittelständischen) Ausbildungsbetrieben deren Einschätzung zu den sprachlichen Leistungen von Schulabgängerinnen und Schulabgängern zu Beginn ihrer Berufsausbildung erfragt.
Die Umfrage sollte Erkenntnisse darüber liefern, inwieweit diese Leistungen sich tatsächlich, wie es immer wieder behauptet wird, deutlich verschlechtert haben, und in welchen Bereichen der Sprachkompetenz besondere Defizite sichtbar werden.
Etwa drei Viertel der befragten Unternehmen hatten den Eindruck, dass die sprachlichen Fähigkeiten ihrer Ausbildungsbewerber in den Bereichen Rechtschreibung, Grammatik und Wortschatz seit Jahren rückläufig sind.
Besonders schlecht stellte sich die Fähigkeit des schriftlichen Ausdrucks dar: nur etwas mehr als ein Drittel der Schulabgänger verfügten in dieser Hinsicht nach Einschätzung der Betriebe noch über wenigstens „ausreichende“ Fähigkeiten. Das galt weitgehend unabhängig davon, ob die Schülerinnen und Schüler einen familiären Migrationshintergrund hatten oder nicht.
Vom Sprachunterricht an den Schulen erwarteten die befragten Betriebe eine stärkere Ausrichtung seiner Anforderungen an den praktischen beruflichen Bedürfnissen sowie eine stärkere Berücksichtigung des schriftlichen Bereichs bei der Notengebung.
Das genaue Ergebnis und die Daten zu der Umfrage, die im Zeitraum Sommer 2019 bis Januar 2020 durchgeführt wurde, und an der sich insgesamt 63 Unternehmen beteiligt haben, finden Sie hier (pdf-Datei).
Wenn Sie über eigene Erfahrungen mit Auszubildenden verfügen, können Sie uns diese auch weiterhin mitteilen. Das Formular der Umfrage finden Sie hier.
Deutschunterricht im digitalen Zeitalter und unter dem Einfluss von KI
Der Anspruch einer fehlerfreien Rechtschreibung und korrekten grammatischen Ausdrucks, findet Julia Knopf, Professorin für Deutschdidaktik an der Universität des Saarlandes, sei gerade im Hinblick auf das digitale Zeitalter von enormer Wichtigkeit, weil es in der digitalen Welt noch mehr als in der analogen auf Genauigkeit und Präzision ankomme und weil digitale Medien nicht über die Fähigkeit der Interpretation oder über pragmatisches Textverständnis verfügten. (sueddeutsche.de) Auch wir stellen uns die Frage: soll Spracherwerb sich künftig der digitalen Kommunikation unterordnen – oder sollen die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation und der Umgang mit digitalen Medien im Dienst des Spracherwerbs stehen?
Wie wirkt sich die fortschreitende digitale Kommunikation auf die Entwicklung aktiver individueller Sprachkompetenz aus? Und was leistet die Schule eigentlich noch an aktivem Sprachunterricht, um Schülerinnen und Schüler bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen?
Unter anderem lieferte die coronabedingte Einführung von Fernunterricht dazu gewisse Erkenntnisse: Einerseits sorgte sie für eine bessere digitale Ausstattung der Schulen. Andererseits scheint der Verlust an Lernzuwachs, besonders im Hinblick auf sprachliche Kompetenzen unbestreitbar.
Inzwischen bedroht auch die allgemein zugängliche KI die traditionellen Zielsetzungen eines auf Kompetenzzuwachs zielenden aktiven Sprachunterrichts.
Wie Julia Knopf gehen wir von der (konservativen) Vorstellung aus, dass Deutschunterricht vor allem die Fähigkeit von Jugendlichen weiterentwickeln sollte, sich mit den vielfältig verfügbaren Informationen sprachlich und gedanklich kompetent auseinanderzusetzen. Das bedeutet zum einen, dass gründliches und systematisches, verstehendes Lesen gelernt und geübt werden muss. Zugleich ist die Fähigkeit zu präziser aktiver Kommunikation gefordert. Einen reichhaltigen Wortschatz und ein möglichst breites Spektrums an sprachlich formalen Mustern braucht es, um gedanklich differenziert zu urteilen und um sprachlich flexibel und sensibel zu formulieren. Anders ausgedrückt: Schülerinnen und Schüler müssen angehalten werden, sich um ein gutes und niveauvolles Deutsch zu bemühen, und sie sollen ihre Persönlichkeit namentlich über eine gründliche sprachliche Bildung entfalten – und zwar jenseits der digitalen Möglichkeiten, die sich ihnen bieten.
Letztlich bleiben die individuellen sprachlichen und logischen Kompetenzen die Basis für die angemessene Wirklichkeitserfassung und für eine präzise, ausgewogene Wirklichkeitsbeschreibung
Entscheidend ist also, dass Digitalisierung nicht Ziel des Sprachunterrichts sein kann, sondern umgekehrt Sprachunterricht ein Ziel digitalen Arbeitens.
Wie ist Sprachwandel zu bewerten – ein Test
Anlässlich der Didacta, die in diesem Frühjahr in Stuttgart stattfand, hat der VDS eine Befragung zum Thema „Sprachwandel“ im Deutschunterricht entwickelt und durchgeführt.
Teilnehmende Lehrerinnen und Lehrer sollten sich darin erklären, wie sie nicht (mehr) normgerechte Formulierungen im Bereich Ausdruck und Grammatik in schriftlichen Schülertexten bewerten.
Zu Sätzen wie „wegen dem schlechten Wetter …“ oder „Die Bedarfe an Lehrkräften nehmen zu…“ war eine Einstufung mit drei Optionen vorzunehmen:
- Bewertung als Fehler
- Bewertung als „ungenau“ ggf. mit Verbesserungsvorschlag
- Bewertung als zulässig / unproblematisch bzw. ohne Beanstandung
Interessant dabei: Formulierungen, die einen tatsächlichen Sprachwandel über die Umgangssprache widerspiegeln, werden weiterhin zu hohen Anteilen von über 80 % als „fehlerhaft“ eingestuft. Dazu gehörten der genannte Gebrauch des Dativs bei der Präposition „wegen“ oder die Wortstellung im Nebensatz mit „weil“ – also: „Auf dem Schulhof darf nicht mit Schneebällen geworfen werden, weil es ist zu gefährlich.“
Auch die falsche Kasusform „Er hatte ein Mann gesehen“ im Akkusativ wurde sicher zu Recht weiter von beinahe allen als Fehler gekennzeichnet.
Andererseits gab es Sätze, in denen durch falsche logische Bezüge oder durch einen undeutlichen Ausdruck auch inhaltliche Unklarheiten verursacht wurden – z. B. „Die Kinder helfen sich gerne bei den Hausaufgaben“ (statt helfen sich gegenseitig / helfen einander) oder „Der Schüler gab an, er hätte die Klausur versäumt, weil der Bus zu spät kam“ (statt: gab an, er habe die Klausur versäumt …) Diese Fehler wurden umgekehrt von vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern kaum beachtet.
Auch an einer anglizistischen Adaption wie „Es macht Sinn, dass…“ nahm eine deutliche Mehrheit der korrigierenden Kollegen keinen Anstoß. Nicht zuletzt die Floskel „Unser Theaterbesuch hat leider nicht geklappt“ (statt „ist nicht zustande gekommen / musste leider ausfallen“) wurde kaum beanstandet. Was „lernt uns das?“ könnte man fragen:
Sprachwandel findet sichtbar Eingang in das, was als Standardsprache gilt, oder anders ausgedrückt:
Auf eine Unterscheidung zwischen Alltagssprache und Standardsprache wird auch in der Lehrpraxis im Deutschunterricht immer weniger Wert gelegt. Und nicht zuletzt:
Logische Ungereimtheiten fallen offenbar weniger ins Auge als vordergründige grammatische Gebrauchsvarianten.
Unabhängig von den vorgenommenen Bewertungen wurden unter allen Teilnehmern Sachpreise verlost. Die Gewinner wurden benachrichtigt.
Der Fragebogen mit den insgesamt zwölf Satzbeispielen sowie die Übersicht über die Bewertungsvarianten sind hier aufrufbar.
Deutsch als „Bildungssprache“ in der Schule
Die Kultusministerkonferenz des Bundes und der Länder (KMK) hat im Jahr 2019 ein Grundsatzpapier zum Thema „Stärkung der Bildungssprache Deutsch“ verabschiedet. Der Sprachunterricht soll demnach durchgängig eine stärkere Akzentuierung in allen Bildungsabschnitten und Bildungsgängen erhalten und als „Querschnittsaufgabe“ für alle Fächer und Lernbereiche verstanden werden.
Die Leitforderungen und die Inhalte des Papiers finden sich unter der Netzadresse: kmk.org.
Die Arbeitsgruppe Deutsch in der Schule hat zu den Inhalten des Papiers und zu den von den Bundesländern eingereichten Angaben eine vergleichende Übersicht erstellt.
Im Ergebnis kann man feststellen, dass zwar fast alle Bundesländer eine respektable Breite an Maßnahmen zur Förderung von Sprachkompetenz bei Kindern mit erschwerten sprachlichen Lernbedingungen z.B. durch einen Migrations- oder bildungsfernen familiären Hintergrund bereithalten, dass aber Impulse zur Stärkung bildungssprachlicher Elemente im „muttersprachlichen“ Unterrichtsfach Deutsch nur noch wenig präsent sind. Besonders beim Vergleich der Fortbildungsangebote findet sich dazu kaum etwas. Sehr unterschiedlich stark sind entsprechende inhaltliche Vorgaben oder thematische Akzentuierungen in den jeweiligen Lehrplänen (Schwerpunkt Sekundarstufe I) vertreten. Diese waren zwar nicht ausdrücklich Teil der KMK-Erhebung, müssen aber bei einer Gesamtbetrachtung natürlich berücksichtigt werden.
Die vergleichende Übersicht enthält zu jedem Bundesland eine abschließende Bewertung. Sie können Sie durch einen Klick auf das entsprechende Bundesland über die Karte aufrufen.
Erläuterungen zum Vorgehen und zur Beurteilung sowie die Leitfragen zur Bewertung nach fachdidaktischen Aspekten finden Sie hier.
Eine Zusammenfassung des Ergebnisses finden Sie hier.
Zehn Thesen zur Stärkung der Bildungssprache Deutsch in der Schule aus der Sicht des VDS finden Sie hier.
Kernlehrplan Deutsch Sekundarstufe I – 2019
Im Rahmen der Verbändebeteiligung wurde der VDS im Frühjahr 2019 aufgefordert, eine Stellungnahme zum neuen Kernlehrplan Deutsch für die Sekundarstufe I (in diesem Fall in NRW) abzugeben.
In unserer Stellungnahme stellten wir Schwachstellen des Lehrplanentwurfs heraus und machten mehrere Verbesserungsvorschläge. Eine unserer Forderungen darin lautete, dass die zentrale Aussage aus dem Kernlehrplan 2007 erhalten bleibt: Deutschunterricht ist Sprachunterricht. Diese war tatsächlich in dem neuen Entwurf nicht mehr enthalten (!). Außerdem sollten nach Ansicht des VDS literarische Texte in den Deutscharbeitsbüchern wieder einen größeren Raum erhalten, die Wortschatzerweiterung stärker akzentuiert und mehr Wert auf den Aspekt der Hoch- oder Bildungssprache gelegt werden.
Kurz vor den Sommerferien wurde nun der überarbeitete Lehrplan veröffentlicht – Fazit aus Sicht des VDS:
Ja, der Satz: „Deutschunterricht ist Sprachunterricht.“ wurde wieder aufgenommen – und ja: die Schülerinnen und Schüler sollen am Ende der Sekundarstufe I „normgerecht sprechen und schreiben können.“ Auch das steht auf Drängen des VDS jetzt wieder im Lehrplan. Die geforderte Stärkung der elementaren Fähigkeiten in Wortschatz und Grammatik fand jedoch wenig Niederschlag – insgesamt blieb es bei weitgehend unkonkreten, schwammigen und wenig verbindlichen Formulierungen zur Beschreibung der Aufgaben des Deutschunterrichts. Es hängt also nach wie vor an den Vorstellungen der Lehrerinnen und Lehrer, dieser Notwendigkeit in der Praxis Rechnung zu tragen – im Interesse ihrer Schülerinnen und Schüler. Deren individuelle Bildungschancen und deren Aussicht auf persönliche und berufliche Entwicklung sollten allen, die die Sprache unterrichten, so viel wert sein, dass sie sich durch pädagogische Allgemeinplätze und didaktische Spruchblasen auch in Lehrplänen nicht vom Wesentlichen ablenken lassen.
Claus Günther Maas
Lehrplan Deutsch Sekundarstufe II
Überarbeitung des Kernlehrplans Deutsch für die Gymnasiale Oberstufe (hier: NRW)
Mit Beginn des Schuljahres 2023/24 wurde der Kernlehrplan Deutsch für die GO von 2013 durch eine Neufassung ersetzt. Im Rahmen der frühzeitigen Verbändebeteiligung konnte der VDS eine Stellungnahme zu dem entsprechenden Entwurf abgegeben.
Eine Bewertung der jetzt in Kraft getretenen Fassung unter Berücksichtigung der von uns vorgebrachten Einwände und Anregungen wird es in Kürze auf dieser Seite geben.
Soweit Sie Fragen zu den Lehrplanentwürfen anderer Bundesländer haben, wenden Sie sich an uns unter der Adresse: claus.maas@vds-ev.de.
Gehört Gendersprache in die Schule?
An Anreden wie „Liebe KollegInnen“ oder „An die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 10“ hat man sich beinahe gewöhnt . Ob auf internen Mitteilungen oder Arbeitsblättern gilt das jetzt als neue Form von angeblich „inklusiver“ Höflichkeit.
Ist das eigentlich rechtens? Nein – ist es nicht, denn wenngleich solche Formen im internen Schriftverkehr inzwischen (aus Vereinfachungsgründen) weitgehend geduldet werden, gibt es klare Vorgaben für das offizielle Schreib- und Anredeverhalten, nämlich zum einen das „Verwaltungsverfahrensgesetz“ (BVwVfG), und zum andern die „Amtliche Regelung Deutsche Rechtschreibung“, die ausdrücklich feststellt, dass die vom „Rat für deutsche Rechtschreibung“ formulierten Vorgaben „innerhalb derjenigen Institutionen (Schule, Verwaltung)“ Gültigkeit haben, „für die der Staat Regelungskompetenz hinsichtlich der Rechtschreibung“ besitzt.
Der Rat hat diese Auffassung mit dem neuen Amtlichen Regelwerk 2024 bekräftigt.
Dem werden nun ca. 10.000 aufgeregte Gleichstellungsbeauftragte und deren Getreuen entgegenhalten, dass doch Gleichstellungsgesetze des Bundes und der Länder eine gegenteilige Feststellung träfen – nämlich:
dass „Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Bundes … die Gleichstellung von Frauen und Männern auch sprachlich zum Ausdruck bringen“ sollen (§ 3 BGleiG 2015). U.a. in Vordrucken seien „geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen zu verwenden“ bzw. ersatzweise „die weibliche und die männliche Sprachform“. (LGG NRW 2002)
Aber: Was viele Behörden und Körperschaften ihren Beschäftigten mit so genannten „Leitfäden“ oder „Empfehlungen“ zur „geschlechtergerechten Sprache“ zumuten, hat mit diesen Vorgaben nichts zu tun und ist in keiner Weise durch das Gesetz abgedeckt. Insbesondere ist dort keine Rede von Signaturen wie „Genderstern“, Binnen I, Unterstrich oder Doppelpunkt.
Eine sprachwissenschaftliche Fachorganisation wie die „Gesellschaft für deutsche Sprache“ (GfdS) hat im August 2020 zum Gendersternchen eindeutig festgestellt. „Es eignet sich nicht, um genderneutrale Personenbezeichnungen zu bilden. Bei seiner Verwendung entstehen nicht nur grammatisch falsche Formen (z. B. Arzt*in oder Ärzt*in), auch den Regeln der deutschen Rechtschreibung entspricht das Sternchen nicht.“
Die Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS) hat auf ihrer Jahrestagung im Februar 2021 einen Antrag auf Einführung des Gendersterns in ihre Satzung mit deutlicher Mehrheit abgelehnt und der Direktor des Leibnitz-Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim konzidiert in einem Interview mit dem „Spiegel“ (Nr. 10 2021), dass der Genderstern „derzeit nicht zum Zeichenbestand der deutschen Orthographie“ gehört, weshalb man streng genommen seine Verwendung „in der Schule also als Fehler anstreichen“ müsse.
Fazit: „Gendersternchen, Gender_Gap und andere sprachentstellende Konstruktionen haben … weder in Wochenplänen noch in Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblätternetwas verloren“ – denn: „All diese Formen“ sind „nicht konform mit den Regeln der deutschen Grammatik sowie denen der Rechtschreibung.“ (So formulierte es zu Recht ein Vater zweier schulpflichtiger Töchter, der sich schriftlich beim zuständigen Ministerium für Schule und Kultus in München beschwerte.)
Unter diesem Link finden Sie ein aktualisiertes Merkblatt zur Verwendung bzw. Nichtverwendung von Elementen so genannter „geschlechtergerechter Sprache“ in der Schule.
Ein sehr hilfreiches Video zur Diskussion des Themas im Unterricht finden Sie hier: youtube.com.
Eine Schwerpunktausgabe der VDS – Sprachnachrichten mit dem Thema „Deutsch in der Schule“ hat sich im August 2022 u. a. mit der Genderfrage beschäftigt – die Ausgabe kann unter dem Menüpunkt Sprachnachrichten 2022 nachgelesen werden.
Umfangreiches Material zur Diskussion zum Thema erhalten Sie auf Wunsch über eine Anfrage bei claus.maas@vds-ev.de
Als Argumentationshilfe u.a. zu empfehlen ist der Aufsatz: „Geschlechtergerchte Sprache – ein Muss in der Schule ?“ in
„Schulmagazin 5-10“ Nr. 3/4 2024 Seiten 31ff. von Claus Günther Maas.
Für Referate und Diskussionen in Schulen stehen wir gerne zur Verfügung – Anfragen ebenfalls über: claus.maas@vds-ev.de
Alle interessierten Kollegen und ausdrücklich auch Kolleginnen sowie Eltern oder Schüler sind herzlich eingeladen, uns ihre eigenen Beobachtungen und Erfahrungen damit unter claus.maas@vds-ev.de mitzuteilen.
Aktion Lehrer gegen Gendern
Seit mehreren Jahren schleicht sich gegenderte Sprache unter dem Begriff „geschlechtergerecht“ in den Alltag der Schulen ein, sowohl in interne Texte als auch in Unterrichtsmaterialien und in die Kommunikation nach außen Begründet wird das mit gesellschaftstheoretischen Glaubenssätzen, die zu geltenden Sprachnormen, sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen und pädagogischen Grundsätzen im Widerspruch stehen.
Als Lehrerinnen und Lehrer wehren wir uns gegen diese Praxis und bestehen auf folgenden Grundsätzen:
- Mit dem Begriff „geschlechtergerechte Sprache“ wird eine unzulässige Aufwertung versucht, die in der Sache nicht gerechtfertigt ist. Er suggeriert, dass die Nichtverwendung solcher Sprachformen „ungerecht“ sei, und führt so zur Störung des kollegialen Friedens. Er soll deswegen in der schulischen Kommunikation nicht verwendet werden.
- Soweit Kollegen auf die Verwendung von gegenderter Sprache Wert legen, muss dies in einer Weise geschehen, die mit den geltenden Sprachnormen der Orthographie, der Grammatik und der Lexik des Deutschen in Einklang steht.
- Insbesondere ist die Verwendung von Binnen-I und Sonderzeichen im Wortinnern zu unterlassen, die der Rat für deutsche Rechtschreibung wiederholt für nicht vereinbar mit der Amtlichen Regelung der Orthographie erklärt hat. (rechtschreibrat.com)
- Die „Leitlinien für Chancengleichheit durch geschlechtersensible schulische Bildung und Erziehung“ vom 6.10.2016 (kmk.org) rechtfertigen keine Verformung und Verfälschung der sprachlichen Logik und Systematik.
- Gerade geschlechtersensible und wertschätzende Kommunikation in der Schule erfordert sowohl gegenüber Kollegen als auch gegenüber Schülern einen korrekten Sprachgebrauch.
- Einwirkungen von Lehrpersonen auf Schülerinnen oder Schüler, die unter Berufung auf angebliche „Geschlechtergerechtigkeit“ stattfinden, sind unter dem Aspekt des „Nichtüberwältigungsgebots“ aus dem „Beutelsbacher Konsens“ unzulässig.
- Sinnvoll ist stattdessen eine normenkonforme Thematisierung des Phänomens gegenderter Sprache in sprachlichen Fächern, ggf. auch in erziehungs- bzw. gesellschaftswissenschaftlichen oder ethisch-philosophischen Zusammenhängen.
- Die Anwendung grammatisch oder orthographisch fehlerhafter Formulierungen durch Lehrpersonen in unterrichtlichen Zusammenhängen, im Gespräch, in Arbeitsblättern und Arbeitsaufträgen sowie in sonstiger innerschulischer Kommunikation ist nicht zulässig.
- Bei der Bewertung mündlicher und schriftlicher Schülerbeiträge ist auf eine fehlerhafte Benutzung gegenderter Sprache korrigierend hinzuweisen. Das gilt besonders bei sinnentstellenden Formulierungen.
- Logische Fehlleistungen entstehen (neben einer nicht normgerechten Orthographie und Satzgrammatik) besonders häufig durch missverständliche Geschlechter-Beidnennungen ohne konkreten Personenbezug sowie durch die sinnentstellende Verwendung von Partizipialformen.
- Schulischen Gremien obliegt keine Entscheidungsgewalt über etwaige Abweichungen vom normgerechten Sprachgebrauch, der durch Lehrpläne und Verwaltungsrichtlinien vorgeschrieben ist.
- Die Schulleitungen haben im Rahmen ihrer Leitungsverantwortung für die Einhaltung der geltenden Vorgaben zu sorgen.
im März 2024 – Initiativgruppe Lehrer gegen Gendern
V.i.S.d.P. Claus Günther Maas
Ein Wort in eigener Sache: Ist der VDS ein „rechter“ Verein ?
Wie Propaganda der gerechten Sache schadet …
Zu Beginn dieses Jahres wurde der VDS durch eine üble Pressekampagne in Misskredit gebracht, …. Mehr lesen …
nachdem sein damaliges Vorstandsmitglied Silke Schröder aus Berlin an der bekannt gewordenen angeblichen „Geheimkonferenz“ in Potsdam teilgenommen hatte. In der darauf folgenden Veröffentlichung bezeichnete die Rechercheredaktion „Correctiv“ den VDS als eine „Vorfeldorganisation“ rechtsradikaler Kreise.
Es folgten zahlreiche Verunglimpfungen von interessierter Seite, Gegner unserer konservativen und ästhetischen Sprachauffassung und besonders Angehörige der Gendersprachfraktion witterten die Chance, uns mit Hilfe dieser Kampagne öffentlich zu diskreditieren.
Obwohl sich der VDS umgehend von den privaten Aktivitäten Frau Schröders
distanzierte und sie ihrerseits die Mitgliedschaft im Vorstand und im Verein aufkündigte, blieb Correctiv bei seiner Darstellung: bis heute wird Silke Schröder in dem Skandalbericht „Geheimplan gegen Deutschland“ fälschlich als „Vorstand“-smitglied im Verein Deutsche Sprache bezeichnet.
Bis in unsere diesjährige Buchpreisaktion für das beste Deutschabitur wurden wir als Sprachverein in Mithaftung genommen: einige Schulen, die in den vergangenen Jahren unseren Buchpreis gerne verliehen haben mel-deten sich in diesem Jahr nicht zurück oder lehnten ausdrücklich ab. In einigen Regionen von Rheinland-Pfalz scheint es sogar aktive Propaganda und Anrufe von Schulen untereinander gegeben zu haben, um vor den „rechtsradikalen“ Aktivitäten des VDS zu warnen.
Dennoch konnten wir auch in diesem Jahr wieder über 400 Buchpreise vergeben – und wir haben keinerlei Rückmeldung, dass von den „Sternstunden“ der deutschen Literatur jemand zu „rechtsradikalen“ Gedanken verführt worden wäre.
Wir danken allen, die sich von den dümmlichen und durchsichtigen Versuchen, uns in eine politische Ecke zu stellen, nicht verunsichern lassen, und hoffen, dass unsere Arbeit im Dienste eines sorgfältigen und wertschätzenden Umgangs mit unserer Sprache auch weiterhin auf Zustimmung und Anerkennung stößt.
Auch im kommenden Jahr wird der VDS besondere Leistungen im Fach Deutsch wieder mit einem Buchpreis belohnen.
Was wir tun
Der VDS ist ein Interessenverein, der die Erhaltung und Pflege eines guten deutschen Sprachgebrauchs zum Ziel hat. Dieses Ziel sollte uneingeschränkt auch der Deutschunterricht an Schulen verfolgen – nicht im Sinne der Auslese, aber im Sinne einer anspruchsvollen Förderung.
Das sind unsere Angebote an alle Befürworter eines aktiv kompetenzfördernden Sprachunterrichts:
- Wir engagieren uns in der Lehrplandiskussion: teilen Sie uns Ihre Kritik an Lehrplaninhalten und Unterrichtsvorgaben mit, die Sie für nicht zielführend halten.
- Wir beteiligen uns durch Veröffentlichungen und Korrespondenzen an der Diskussion um den Sprachunterricht in den Schulen. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Problematik des Sprachwandels einerseits und des Sprachverfalls andererseits.
- Mit Sorge beobachten wir, dass der Deutschunterricht seit Jahrzehnten immer mehr zur Vermittlung von Inhalten statt zur Vermittlung von Fähigkeiten neigt und die Entwicklung der aktiven, vor allem der schriftlichen Spracharbeit vernachlässigt. (siehe Literaturliste)
- Wir suchen und praktizieren die Zusammenarbeit mit Dienstleistern, die sich im Bereich der Förderung schriftsprachlicher Kompetenzen engagieren – zum Beispiel:
- bez. Schreiben mit der Hand: AG Ausgangsschrift
- bez. Rechtschreibförderung: lernserver.de
Der VDS präsentiert seine Vorstellungen und Angebote zur Sprachförderung regelmäßig auf der Fachmesse Didacta und der Leipziger Buchmesse. Folgen Sie dazu den Ankündigungen und Hinweisen auf unserer Internetseite!
Unsere Buchpreisaktion für das beste Deutsch-Abitur
Seit etwa zehn Jahren bieten wir allen interessierten Schulen einen Buchpreis für das beste Deutsch-Abitur an, der i.d.R. aus Anlass der Abiturschlussfeiern als Prämie verliehen wird. Der VDS will damit auf seine Tätigkeit zur Pflege von Sprachkultur hinweisen und junge Menschen für dieses Anliegen gewinnen.
Alle interessierten Kollegien und Deutsch-Fachschaften können sich hier informieren und zur Teilnahme anmelden: Bestes Deutsch-Abitur
Fortbildung
Zu den folgenden Themen bieten wir auf Anfrage Vorträge und Workshops:
- Was leistet Deutschunterricht heute – und was sollten Schüler wirklich lernen?
- Lese– und Sprachförderung als Qualitätsmerkmal des Deutschun-terrichts
- „So spricht doch kein Mensch“ – zur Unterscheidung von Alltags- sprache und Schriftsprache
- „Leicht-Deutsch oder Denk-Deutsch“ – über ein angemessenes Sprachniveau in Schule und Beruf
- Deutsch – soziale Fremdsprache auch für Muttersprachler?
- Was heißt eigentlich „sprachliche Leistung“? – Bewertung von Darstellungsleistungen und deren Verbesserung
VDS bei der didacta
Vom 11. – 15. Februar war der VDS bei der didacta in Stuttgart mit einem eigenen Stand vertreten – Standort: Halle 5, Stand 5C51. Bericht folgt.
Hier finden Sie unser Programm:
Sie interessieren sich für unsere Themen und können nicht vor Ort sein? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter claus.maas@vds-ev.de – Stichwort: Deutsch in der Schule
Wir bieten Ihnen:
Vorträge und Fortbildungen zum Thema „Deutsch-Unterricht ist Sprachunterricht – alte und neue Forderungen an die künftige Deutschdidaktik“
Informationen und Hilfestellungen zu den Themen:
- Ausgangsschrift und Hilfestellung bei Handschriftproblemen
- Gendersprache – was geht und was nicht in der Schule?
- „Konzeptionelle Schriftlichkeit“ im Unterricht – was heißt das?
- Schreiben – Schreiben – Schreiben, unverzichtbare Fähigkeit in Zeiten von Digitalisierung und KI – und:
- Der Faktor „Zeit“ beim Lesen und Verfassen von Texten